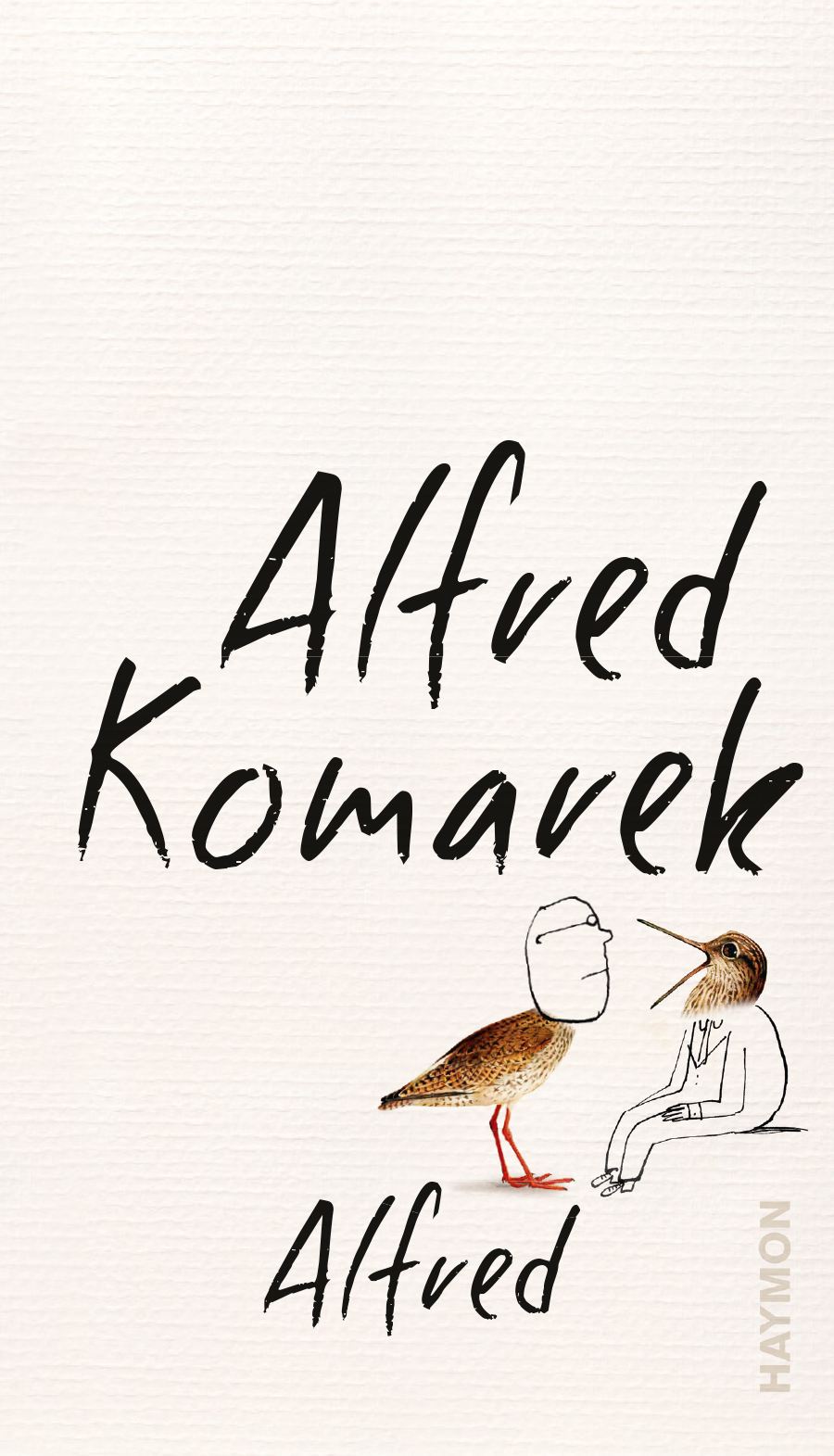Ob in Krimis, Kinderbüchern, Sachbüchern oder Bildbänden: Alfred Komarek verstand es wie kein Zweiter, Lesende mit seinen Worten zu begeistern. Im Nachwort zu Alfred Komareks Werk „Spätlese“ erinnert sich Michael Forcher, der Gründer des Haymon Verlags, an die erste Begegnung mit Alfred Komarek und seinen Werken …
Ich habe ihn mir anders vorgestellt. Nein. Eigentlich habe ich ihn mir überhaupt nicht vorgestellt. Alfred Komarek war für mich schlicht und einfach ein Name, eher abstrakt. Er stand für Geschichten, Gedanken, Worte, Musik. Ja, auch Musik, was natürlich nicht nur mit Wortklang und Sprachmelodie zu tun hat, sondern auch damit, dass es Gedanken, Worte zum Weiterspinnen waren, zum Hineinträumen bei romantischer Musik, zum Sich-hinein-Verkriechen …
Viele, viele Menschen meiner Generation „50 plus“, aber auch Jüngere wissen, wovon die Rede ist: von Alfred Komareks Kultsendung „Melodie exklusiv“, die in den Siebziger- und frühen Achtzigerjahren regelmäßig hunderttausende Menschen zu später Abendstunde vor den Radioapparaten versammelte.
Später las ich wohl das eine oder andere von Alfred Komarek, in einem Merian-Heft, im Geo vielleicht, im Gedächtnis blieb es nicht. Und „Melodie exklusiv“ gab es nicht mehr. Dann gründete ich den Haymon Verlag, hatte Kontakt mit jungen, engagierten Autorinnen und Autoren, aber auch ordentliche Schwergewichte der Branche stießen zum Haymon Verlag. Wir hatten Erfolge zusammen, erlebten Enttäuschungen, und wie jeder Verleger hoffte ich inständig darauf, einmal den großen Coup zu landen.
Eines Tages entdeckte ich unter den gerade eingelangten Manuskripten ein Kuvert mit einem mir wohlvertrauten Namen: Alfred Komarek. Habe ich es falsch in Erinnerung oder schlug mir wirklich plötzlich das Herz bis zum Hals … Dieser Alfred Komarek? Kann das sein?
Tatsächlich, es war dieser Alfred Komarek, und er bot mir das Manuskript seines ersten Kriminalromans zur Veröffentlichung an: „Polt muß weinen“. Nie vorher und auch nachher nicht mehr habe ich mich so schnell ans Lesen gemacht, da galt keine Reihenfolge der eingelangten Manuskripte mehr. Und schon die ersten Sätze faszinierten mich, ein geradezu perfekter Anfang. Ein großer Erzähler war da am Werk. Aber auch ein Sprachkünstler, der mit wenigen Worten dichte Stimmung aufbauen kann.
Nach wenigen Seiten war Komareks Absicht klar: Die vordergründig gar nicht so spannende, aber letztlich packende und berührende Kriminalgeschichte mit – wie es sich erweisen sollte – überraschender Lösung war mit dem Hintergedanken geschrieben worden, den Leser*innen die dörfliche Welt der Weinbäuer*innen in der nordöstlichen Ecke Österreichs vorzustellen. Der Mord und seine Aufklärung waren sozusagen die Folie, auf der Komarek das Charakterbild einer Region und ihrer Menschen entwarf. Als Alfred Komarek mit dem ersten Simon-Polt-Roman „Polt muß weinen“ den renommierten Glauser-Preis gewann, stand denn auch die „Einfühlsamkeit, mit der der Autor die Menschen und die Landschaft des kleinen Ortes im Weinviertel nördlich von Wien beschreibt“ neben „der atmosphärischen Dichte und Bildhaftigkeit von Komareks Sprache“ im Mittelpunkt der Urteilsbegründung.
Aber ich eile voraus. Zunächst einmal war ich sofort entschlossen, den Roman ins Programm zu nehmen. Ein paar Jahre vorher hatten wir mit Kurt Lanthalers Tschonnie-Tschenett-Romanen erste Schritte auf dem Sektor der Kriminalliteratur gewagt, wobei für mich neben der literarischen Qualität der sozialkritische Akzent im Schreiben des Südtiroler Autors entscheidend war, der nicht nur unterhalten, sondern aufklären will und seine Geschichten so nahe wie möglich an der Wirklichkeit entlang erzählt. Der Erfolg blieb nicht aus. Auch die bald darauf gestarteten Kurt-Ostbahn-Krimis von Günter Brödl erreichten große Popularität und dementsprechend hohe Auflagen.
Und jetzt Alfred Komarek! Wie er mir später sagte, hatte er als verlagstreuer Autor den Roman zuerst mehreren größeren Verlagen angeboten, mit denen er schon in Kontakt stand. Die waren aber skeptisch und trauten sich nicht drüber. Wozu jetzt ein Krimi? Soll bei seinem Leisten bleiben, haben die wohl gedacht. Freund*innen und Kolleg*innen rieten Komarek dann, sich an den Innsbrucker Haymon Verlag zu wenden, der inzwischen zu einer der ersten Adressen in Österreich für dieses Genre geworden war.
Meine umgehend abgesandte Zusage, den Roman zu verlegen, war mit der Bitte verbunden, uns bald einmal in Wien treffen und persönlich kennenlernen zu können. Und da stand er vor mir. Erstmals leibhaftig. Er, der vorher nur Wort, nur Sprache war. Im Café Schwarzenberg war es, nach dem Eingang gleich links, ein Tisch im Eck am Fenster. Er hatte beschrieben, wo er sitzen würde. Stand auf, als er meinen suchenden Blick bemerkte. Herr Komarek? Herr Forcher? Grüß’ Sie Gott, freut mich … Ein großer, schlanker Mann mittleren Alters, im dezenten Straßenanzug mit eher altmodischer Krawatte. Freundlich, gewinnend. Ohne jede Starallüre.
Wir fanden uns im Reden, wurden schnell einig über Detailfragen des zu schließenden Vertrags, besprachen Termine, PR-Maßnahmen und was sonst alles dazugehört zum Geschäftlichen. Ich ließ mir vom Weinviertel erzählen, was ihn so fasziniert an der Landschaft dort, an den Menschen, warum er nach Rundfunk- und Magazinfeatures, Reisereportagen, kleinen Erzählungen, Essays, Texten zu Bildern, zu Kunst und Kultur und vielen anderen Facetten des Schreibens jetzt zum Krimiautor geworden war, der schon weitere Romane rund um den sympathischen Weinviertler Gendarmerie-Inspektor im Kopf hatte. „Ich wollte einen Lebensraum und seine Menschen, die Vorteile und Probleme des heutigen Lebens auf dem Land einmal nicht in Reportage- oder Sachbuchform darstellen, sondern es auf andere Weise probieren, und der Kriminalroman eignet sich dazu besonders gut, weil ein Mord den Alltag auseinanderklaffen lässt und verdrängtes, verleugnetes Unbewusstes herzeigt.“
Seit dem Tag sind mehr als zehn Jahre vergangen. Komarek hat mich damals gebeten, ihm ein strenger Lektor zu sein, allzu häufig verwendete Formulierungen und auffallende Lieblingswörter gnadenlos herauszustreichen, ja nichts durchgehen zu lassen. Ich bin dem Wunsch nachgekommen, doch habe ich nicht viel gefunden, was man hätte herausstreichen müssen. Selbst das angelernte Bemühen, unnötige Adjektiva auszumerzen und die Eigenschaften der Dinge eher der Fantasie der Leser*innen zu überlassen, ging größtenteils ins Leere.
Denn Komarek ist zwar ein Autor der vielen Adjektiva und Adverbien, doch sind es nie simple Ergänzungen aus dem Alltagswortschatz, sie schränken nie die Fantasie des Lesers ein, im Gegenteil, sie sind wohlüberlegt, überraschend kreativ, kaum eines ist verzichtbar, will man nicht den Sinn des ganzen Satzes, die Bedeutung der Aussage entstellen, ein Fenster zumachen, das der Autor durch gerade dieses Wort geöffnet hat.
Sehr oft verändern, relativieren die gewählten Eigenschaftswörter die Bedeutung des Hauptwortes, mildern, verschärfen, ja verkehren sie raffiniert ins Gegenteil, gibt ein Adverb dem folgenden Zeitwort einen neuen Sinn. Bei welchem Autor liest man sonst von „grausamer Zärtlichkeit“, wer beschreibt ein „Fest von sanfter Zügellosigkeit“, wer lässt einen Menschen „aufdringlich entspannt“ sein? Beispiele über Beispiele könnte man da anführen. Komareks Wörter treffen den Kern, durchdringen wie Röntgenstrahlen die äußere Wahrnehmungsschicht, legen tiefere Ebenen frei.
Und dann seine pointierte Sprache, sein Witz, seine Bonmots! Eine Formulierung wie „Die Existenz eines freiberuflichen Schriftstellers ist der eines Seiltänzers ohne Netz verdammt ähnlich“ könnte man auch bei anderen lesen. Bei Komarek kommt was nach „… und zuweilen fehlt auch noch das Seil.“ Niemand Geringerer als der verstorbene Altmeister unter Österreichs Sprachkünstlern, Hans Weigel, war von solchen Sätzen begeistert. Auch von dem: „Schön miteinander schweigen ist übrigens auch ein Gespräch.“ Dass diese Begabung Komarek zum Essayisten und Feuilletonisten alter Schule adelt, hat Hans Weigel im Vorwort zu Komareks Buch „Gott hab uns selig“ – aus dem in der vorliegenden Sammlung auch zahlreiche Beispiele abgedruckt sind – mit der Bemerkung hervorgehoben: „Als Alfred Polgar starb, nannte ich ihn in meinem Nekrolog den ‚letzten Ritter des Feuilletons‘. Ich bin glücklich, dass ich mich damals geirrt habe.“
Feuilletonistische Schärfe in Wortwahl und Formulierung sind das eine, Komareks Erzählkunst eine andere. Denn wunderbare Sätze, überraschende Metaphern und gescheite Gedanken machen noch keinen Roman aus. Geübt und erfahren in der kleinen Form märchenhafter Erzählungen, ausgestattet mit unbändiger Fantasie einerseits und exzellenter Beobachtungsgabe andererseits, dazu noch mit einem auch analytisch einsetzbaren Verstand, dem einige Semester Jusstudium offenbar nicht geschadet haben, ist er imstande, spannende Plots zu erfinden, Dialoge, Szenen und Bilder zu einer sinnvollen Handlung zusammenzuführen. Ein guter Erzähler eben, es gibt nicht gar so viele, leider!
Das Stichwort „Jusstudium“ erinnert mich daran, dass noch die Biografie Alfred Komareks zu erzählen ist. Geboren ist er am 5. Oktober 1945 in Bad Aussee. Sein Vater war Lehrer und Gelegenheitsautor, der dem Drittgeborenen die Lust am Formulieren und Erzählen vererbte, was sich schon früh in einer „übermütigen Hemmungslosigkeit im Umgang mit dem Material Sprache“ (O-Ton Komarek) niederschlug. Nach der Matura am Gymnasium in Stainach-Irdning bremste der Vater den Wunsch des geradezu schreibwütigen Sohnes, gleich als freier Autor tätig zu werden und riet ihm, zur Absicherung ein Jusstudium zu beginnen.
Für diese Argumentation hatte Alfred Komarek durchaus Verständnis, inskribierte in Wien und legte nicht nur die ersten beiden Staatsprüfungen ab, sondern bewährte sich auch als wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Deutsche Rechtsgeschichte. „Ich bereue das bis heute nicht“, betont der erfolgreiche Autor im Rückblick, „denn wer mit dem kreativen Chaos in seinem Inneren produktiv umgehen will, sollte es auch gelernt haben, folgerichtig zu denken und ein stimmiges Konzept umzusetzen.“ Neben dem Studium machte der angehende Jurist das, was er am liebsten tat, nämlich schreiben, ab 1965 für den ORF, ab 1966 als freier Mitarbeiter der Wochenzeitung „Die Furche“. Aber der Stern des Alfred Komarek ging erst richtig auf, als die Geschichte des Rundfunks in eine neue Phase trat, als er – wie Komarek sagt – erwachsen wurde, sich nicht mehr für Unterhaltung genierte und nach der Rundfunkreform von 1968 mit Ö3 ein „junges“ Programm aus der Traufe hob.
Darin wurde dem Wort eine neue Dimension eingeräumt. Zwar waren es nach dem Vorbild der Programme der amerikanischen Besatzungstruppen in Europa meist frei sprechende Moderator*innen, die wortwörtlich das Sagen hatten, doch gelang es Komarek, radiogerechte Texte, Texte zum Hören zu schreiben, die von grandiosen Sprecher*innen wirkungsvoll an die Hörer*innen gebracht wurden, zuerst in „Entre nous“ von Erika Mottl und Wolfgang Hübsch, dann in „Melodie exklusiv“ von Meinrad Nell und Ingrid Gutschi, später in der Reihe „Texte“ von Ernst Grissemann. Gleichzeitig entstanden jede Menge anderer Manuskripte fürs Radio, für österreichische Lokalsender genauso wie für große, deutsche Rundfunkanstalten. Alfred Komarek war etabliert, verdiente ordentlich, war inzwischen glücklicher Ehemann, ging einer schönen Zukunft entgegen. Da passierte es. Seine Frau wurde das Opfer einer schweren psychischen Erkrankung, ihr Tod riss auch ihn in eine existenzielle Krise. „Ich wär auch bald draufgegangen“, sagt er nun. Er ist einer, der nie viel von sich erzählt. Aber wenn er schon nicht anders kann, als diese Katastrophe seines Lebens zu erwähnen, vergisst er nie dazuzusagen, dass es eine wunderbare Ehe war und er deshalb nur mehr allein weiterleben wolle. „So eine Frau finde ich nie mehr, wozu also noch einmal an Heirat denken …“ Wie sehr dieser gewaltige Lebenseinschnitt Komareks Schaffen beeinflusste, ist schwer zu sagen. Man müsste genaue Textvergleiche anstellen, um Spuren zu finden. Und würde sich wohl oftmals täuschen. Der Tod als Teil des Lebens war für ihn schon sehr früh ein gar nicht seltenes Thema, mit dem er – so wie heute auch – leicht und spielerisch umging, in Märchen und Bilder verkleidet. Manchmal verwirrten seine Texte gerade junge Fans. „Also, ich weiß nicht, sind Sie ein junger Alter oder ein alter Junger“, schrieb ihm eine Hörerin in den Siebzigerjahren. Und heute könnte es umgekehrt sein, als „guter Sechziger“ schreibt er so, dass ihn angesichts seiner Unbekümmertheit und seiner Lust am Schabernack vielleicht manch ältere Leser*innen für sehr jung hielten – es soll noch Leute geben, die nichts über Alfred Komarek gehört, gelesen oder ihn im Fernsehen gesehen haben. „Immer mehr fällt mir auf, dass mein Gesicht im Spiegel zwar älter ausschaut, dass meine Interessen, Gedanken und Gefühle aber die gleichen geblieben sind, auch mein berufliches und persönliches Selbstverständnis hat sich in den fünfundvierzig Schriftsteller-Jahren nicht wesentlich geändert.“
Mitte der Achtzigerjahre schlitterte Komarek auch noch in eine berufliche Krise. In allen Programmbereichen des Rundfunks wurde der Wortanteil immer kleiner und von immer besseren Moderator*innen bestritten, für das geschriebene Wort war bald kein Platz mehr. „Als ich im Radio nach und nach verzichtbar wurde, stand ich erst einmal verdutzt da und verarmte rapid. Ich war vierzig und lief, nach langen Beisl-Abenden riechend, jedem, aber auch wirklich jedem Auftrag hinterher, verfolgt von Furcht erregenden Steuerschulden aus besseren Tagen und belächelt von den erfolgreich Etablierten.“
Dass er wieder zu ihnen aufschließen konnte und so manchen überholen, hat Komarek harter Arbeit zu verdanken, seiner Ausdauer, Selbstdisziplin und Professionalität, seinem Fleiß, seiner vielseitigen Begabung und „… einer guten Portion Glück“, ergänzt er bescheiden und versichert glaubhaft, gerade deshalb nie billigen Triumph empfunden zu haben, er wisse genau, ohne dieses Glück hätte es auch anders ausgehen können. Beides, Schöpferkraft und Glück, meinte wohl Journalisten-Urgestein Herbert Völker, sein alter Weggefährte und Förderer, wenn er in einer Laudation auf Alfred Komarek mit einem Alfred-Polgar-Zitat das seltsamskurrile und gerade deshalb so stimmige Bild fand: „Wo er hintritt, da wächst Gras …“
Auf Komareks Lebensweg wuchs jedenfalls bald wieder Gras, dicht und üppig. Zunächst hielt ihn eine „durchaus nicht nutzlose“ Karriere als Werbetexter über Wasser – und mehr als das. Wohl jeder Österreicher kennt einen von Komarek erfundenen Slogan „Raunz nicht, kauf! – Wenn er’s nur aushält, der Zgonc!“
Dann entdeckten Büchermacher*innen und Magazinredakteur*innen Komareks Begabung, über verschiedenste Themen sinn- und lustvoll zu schreiben und dabei im Gegensatz zu anderen genialen Schreiber*innen auch noch verlässlich zu sein und pünktlich abzuliefern. Sowas spricht sich herum in der Branche. Er machte sich vor allem als weltweit agierender Mitarbeiter von Reisemagazinen einen Namen und stellte österreichische Landschaften und Lebensräume, kulturelle Schätze und Naturschönheiten in Büchern vor. Dass er darin weit über das Beschreiben hinausging, veranlasste Hans Weigel, ihn einen „Geosophen“ zu nennen, das Ergebnis dieser Art von Landeskunde eine „Melange aus Anschaulichkeit, Wissen und Charme“. Und: „Ein konstituierendes Element seines Schreibens ist der Humor.“ Fügen wir hier gleich noch das außergewöhnliche Lob eines Berufskollegen und Weggefährten von besonderem publizistischen Gewicht an: Helmut A. Gansterer ließ einmal verlauten: „Komarek hat noch keinen langweiligen Satz geschrieben!“ Ganz schön stark!
Es folgten Sachbücher, profunde Begleittexte für Kunstbücher, Drehbücher fürs Fernsehen. Kleine Erzählungen entstanden, später Kinderbücher. Sogar Liedtexte flossen aus seiner Feder, in den Anfängen „zum Teil abscheuliche Machwerke für diverse Schlager“, wie Komarek heute zugibt, „unter dem Pseudonym Alfred Schilling geschrieben, damit jeder wusste, worauf es mir ankam.“ Später wurden die Texte anspruchsvoller, einige waren für damals prominente österreichische Sänger*innen und Gruppen bestimmt wie die Milestones. In Zusammenarbeit mit Toni Stricker entstand sogar eine CD mit Edita Gruberova als Sängerin. Er lässt sich halt schwer einordnen, dieser Komarek!
Und dann die Romane. Und ihr sensationeller Erfolg. Irgendwie war das Weinviertel an allem schuld. „Ich bin als Stadtflüchtling ins Weinviertel gekommen. Aussee war für einen schnellen Ausflug zu weit weg von Wien. Fasziniert hat mich an dieser Landschaft der Gegensatz zum Salzkammergut: hier eine bergende, bestimmte, spektakuläre Gegend, dort eine weithin offene, auf den ersten Blick beiläufige, leise Landschaft. Dazu die eigentümlichen Strukturen von Dörfern und Kellergassen, die mir bislang völlig fremde Welt der Presshäuser und Weinkeller, archaisch fest gefügt, aber auch verletzlich. Der Weg dorthin, das Bleiben, das Langsam- und Ruhig-Werden ist ein wichtiger Teil meines Lebens.“ Komarek kauft im Pulkautal einen Weinkeller mit dazugehörigem Presshaus, das er sorgfältig und respektvoll herrichtet. Immer öfter verbringt er hier seine Wochenenden und manche Tage dazwischen. Ein zweites Presshaus rettet er durch seinen Kauf vor dem Verfall und erhält sein skurriles Inventar wie ein Museum. Er wird heimisch, lernt die Leute kennen, gehört bald zum lebenden Inventar der Gegend. Und setzt ihr mit seinem Gendarmerie-Inspektor Simon Polt ein literarisches Denkmal.
Das letzte Jahrzehnt habe ich als Komareks glücklicher Verleger selbst miterlebt. Den großen Erfolg mit „Polt muß weinen“ und den Friedrich-Glauser-Preis für den besten deutschsprachigen Krimi; den Lizenzverkauf an den Diogenes Verlag, der mit den Polt-Taschenbüchern neue Leser*innenschichten vor allem in Deutschland erschloss; das Interesse Erwin Steinhauers, den sympathischen Gendarmen zu verkörpern; den Verfilmungsvertrag, das großartige Drehbuch Julian Pölslers (wofür er gemeinsam mit Alfred Komarek 2022 eine Romy erhielt); die von knapp einer Million Österreicher*innen gesehene Ausstrahlung im ORF genau zu dem Zeitpunkt, als der zweite Polt-Roman auf den Markt kam: „Blumen für Polt“. Dann Polt 3 und 4 und die nächsten Filme, Fernseh-Talkshows, Interviews, Lesungen, das allgemein immer größer werdende Echo. Natürlich schrieb Komarek währenddessen auch anderes, darunter ein neues Kinderbuch, Fernsehdrehbücher, ein Theaterstück und für den Haymon Verlag die Texte zu Bildbänden über das Ötztal (Fotos von Guido Mangold), über Venedigs Inselwelten („Laguna“ mit Bildern von Manfred Duda). Einen fünften Polt-Krimi wollte er vorerst nicht mehr schreiben. „Im Pulkautal passieren halt nicht so viele Morde.“ Dem Ansinnen, Polt zur TV- Serienfigur zu machen, widerstand er umso leichteren Herzens. Für Polt sprang Daniel Käfer in die Bresche, ein arbeitslos gewordener Magazinjournalist, den Komarek erfand, um eine andere Landschaft seines Herzens in mehreren Romanen vorzustellen: das Ausseerland. Keine Krimis mehr, aber Romane mit starken Charakteren und einem liebenswerten Völkchen rundherum, mit viel Landschaft, Kultur und Geschichte, witzigen Dialogen und einer spannenden Handlung, eben mit allem, was guten Lesestoff auszeichnet. Der Erfolg der Polt-Romane setzte sich fort, die Filmfirma, Regisseur Pölsler und der ORF stiegen wieder ein. Mit Peter Simonischek erhielt auch Daniel Käfer einen prägnanten, unverwechselbaren Darsteller.
Komareks inzwischen riesige Fangemeinde freut sich auf den vierten und letzten Käfer-Roman, erhofft (nicht aussichtslos) danach einen fünften Polt-Krimi und kommt mit dem vorliegenden Buch endlich auch schwer oder gar nicht zugänglich älteren Texten. Denn wer den echten und wahren Komarek kennenlernen will, muss verschiedenen Spuren folgen und braucht unterschiedliches Futter für seinen Lesehunger. Hier ist es, greifen Sie zu! Aber mit Bedacht. Ich empfehle, denn so hat man mehr davon, es sich langsam und genießerisch Happen für Happen einzuverleiben. Auf diese Weise können Sie mit Alfred Komarek auf Reisen gehen, österreichische Besonderheiten nachsichtig belächeln, alte Autos ausprobieren, der Esslust frönen, ernste Probleme weiterdenken – oder in eine Märchenwelt voller Symbole, Anspielungen, in Wachträume versinken.
Der Beitrag „Schon die ersten Sätze faszinierten mich.“ – Michael Forcher über Alfred Komarek erschien zuerst auf Haymon Verlag.